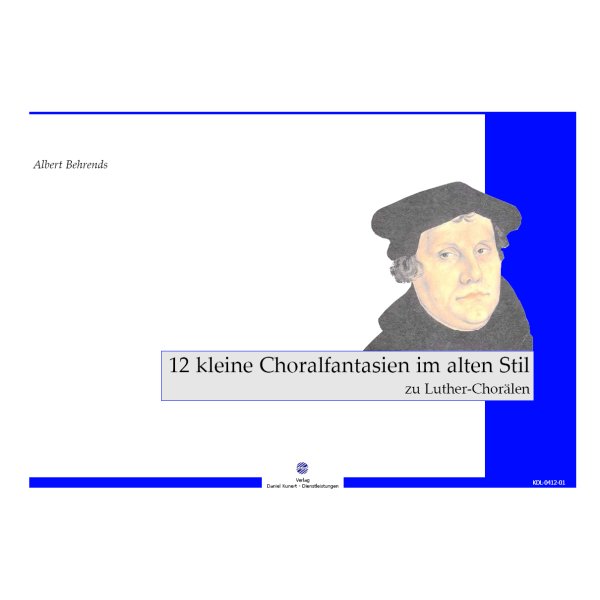|
||
- Startseite - Neuigkeiten / News 2021 - Ostönner Orgelsommer 2021 - Letztes Konzert in diesem Jahr |
||
Ostönner Orgelsommer 2021
Am Samstag den 28.8.2021 um 17:00 Uhr findet in der Ev. St. Andreaskirche in Soest-Ostönnen das letzte Orgelkonzert des Ostönner Orgelsommers 2021 statt. Das Programm verspricht ein sehr abwechslungsreiches und spannendes Konzert. Solist ist Thorsten Ahlrichs aus Ganderkesee. „Unsere Aufgabe ist es nicht nur, die historischen Orgeln zu pflegen, sondern sie auch lebendig zu erhalten, indem sie mit dem ihnen eigenen Repertoire aber auch mit Erweiterungen dessen gespielt werden. Nur so sind die Orgeln nicht reine Museumsstücke, sondern klingende, lebendige Musikinstrumente, die auch heute noch zu uns sprechen“, so Ahlrichs. Es wird um Anmeldung unter folgender e-mail-Adresse gebeten: Teiner74@AOL.com |
||
|
Neue Musik für historische Orgeln Mit der zunehmenden Beschäftigung mit den historischen Orgeln und vorangetrieben von Organisten*innen, die an solchen Instrumenten ihren täglichen Dienst versehen, ist inzwischen ein reiches Repertoire an neu geschaffenen Werken entstanden, die sich mit ihren „Neuen Klängen“ an den Aufführungsmöglichkeiten der alten Orgeln orientieren. Diese Instrumente bieten mit ihren besonderen Bedingungen - seien es der begrenzte Umfang, die Stimmungssysteme, die bestimmte Tonarten begünstigen und andere vollkommen fremd klingen lassen, ihren charaktervollen Klangfarben und mechanischen Eigenarten – zugleich eine reiche Inspirationsquelle für Komponisten und Improvisatoren, Orgelmusik neu zu erfinden und die alten Orgeln ungewohnt und neu erklingen zu lassen. Ein beliebtes Vorgehen ist dabei die Verwendung einer alten Vorlage und die künstlerisch-freie Auseinandersetzung mit dieser. In diesem Konzertprogramm gibt es diesen Ansatz mehrere Male: Die “Estampie voor orgel” von Hans Koolmees hingegen bezieht sich nur teilweise zitathaft auf das vorangestellte Stück aus der ältesten, schriftlich überlieferten Orgelmusik, aus dem Robertsbridge Codex, nimmt aber dessen Form, Rhythmen und tänzerischen Charakter auf. Die Grundlage der abendländischen Musik ist der ursprünglich einstimmige gregorianische Choral. Von der Einstimmigkeit geleitet, schrieb Andries van Rossem ein für die Orgel ungewöhnliches Stück, nämlich ein Stück mit nur einer Stimme – Oneliner! Wo doch die Orgel per se das Instrument der Mehr- und Vielstimmigkeit ist. Im Barock schrieben viele Komponisten Werke für Soloinstrumente, die aber trotz der Einstimmigkeit, auch Harmonien erklingen lassen und z. T. sogar Mehrstimmigkeit vortäuschen oder aber aufgrund des Klanges, der noch im Raum hörbar ist, zumindest mehrere Töne gleichzeitig erklingen. Nun ist unser Gehirn immer dazu geneigt, übergeordnete Linien in der Musik zusammenzufügen und so z. B. einzelne Spitzentöne zu einer Melodie zu machen, die in Wirklichkeit durchaus durch einige Töne unterbrochen sein kann. Paul Hindemith nannte dieses Phänomen den „Sekundanschluss“. Albert Behrends war viele Jahre lang Kirchenmusiker an den bedeutenden Orgeln der ehemaligen Hansestadt Stade. Wie alle, die lange an historischen Instrumenten Dienst tun, begann auch er, das Repertoire für die ihm zur Verfügung stehenden Orgeln zu erweitern. Entstanden aus zahlreichen Improvisationen schrieb er einige Choralbearbeitungen über Luther-Lieder, von denen im Programm die Bearbeitung über das Psalmlied „Es wolle Gott uns gnädig sein“ erklingt. Unsere Aufgabe ist es nicht nur die historischen Orgeln zu pflegen, sondern sie auch lebendig zu erhalten, indem sie mit dem ihnen eigenen Repertoire aber auch Erweiterungen dessen gespielt werden. Thorsten Ahlrichs |
||
| Bitte unterstützen Sie unser "Portal der Königin" mit einem Einkauf in unserem Online-Shop. Vielen Dank. |
||
Pressemitteilung St. Andreas Soest (Reineke) © Foto: Thorsten Ahlrichs |
||
| weiterführende Links: Die Orgel in St. Andreas Soest-Ostönnen |
||

 ragter der Ev. – Luth. Kirche in Oldenburg für die Entwicklung, Koordination und Begleitung von verschiedenen Projekten rund um die historische Oldenburger Orgellandschaft.
Zudem ist er mehrfach als Jury-Mitglied bei Stellenbesetzungen und Förderinstitutionen tätig.
ragter der Ev. – Luth. Kirche in Oldenburg für die Entwicklung, Koordination und Begleitung von verschiedenen Projekten rund um die historische Oldenburger Orgellandschaft.
Zudem ist er mehrfach als Jury-Mitglied bei Stellenbesetzungen und Förderinstitutionen tätig.